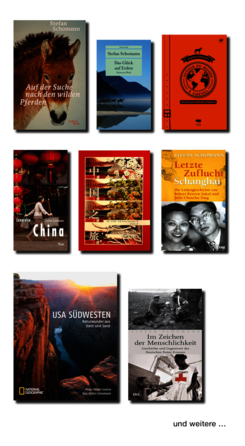Mit Freud in Leiden
Gustav Mahlers letzte Jahre
Im Sommer 1910 geht Gustav Mahlers Leben endgültig entzwei. Innerhalb weniger Wochen macht er die schwerste Krise seiner Existenz und seiner Ehe mit Alma durch – und feiert mit der Uraufführung der Achten Symphonie zugleich seinen größten Triumph als Komponist. Mit dieser „Symphonie der Tausend“ hat er vor seinen Nöten noch Reißaus ins Kolossale genommen. Das Werk aber, an dem er nun fieberhaft schreibt, seine Zehnte Symphonie, spricht eine andere Sprache. Eine waidwunde Seele erzählt von Einsamkeit, Verlust und Tod. Die Symphonie des Einzigen – sein letzter Versuch, dem hereinbrechenden Unheil zumindest als Künstler Herr zu werden.
Anfang August, als er zur Sommerfrische in Toblach am Fuß der Dolomiten weilt, kommt er dahinter, daß seine Frau ein Verhältnis mit einem jungen Architekten namens Gropius hat. So schwer diese Affaire ihn auch trifft, bildet sie doch nur die Sprengladung, die eine schon lange schwelende Krise zum Brand entfacht. Der Tod der Tochter Maria, die Trennung von der Wiener Hofoper, der chronische Streß, die Diagnose eines Herzfehlers – all das hat ihn destabilisiert. Seit eh und je ein Nervenbündel, steht er nun am Rande der Panik und des Irrsinns.
Der da bestürzende Briefe an „mein Almschilitzilitzilitzili“ kritzelt, der sich weinend am Boden windet, Almas Pantöffelchen abküßt und sie zugleich mehr denn je tyrannisiert – er braucht dringend Hilfe. Ein illustrer Spezialist soll sich seiner annehmen: Sigmund Freud. Natürlich sträubt Mahler sich gegen die Sezierung seines Innersten. Schon mehrfach hat er den Seelentermin verschoben, und als Freud ihm von seinem Urlaubsdomizil in Holland aus ein Ultimatum stellt, erleidet er prophylaktisch einen Kollaps. Doch es hilft alles nichts, Frau und Schwiegermutter setzen den Patienten in den Zug. In Franzensfeste, in Innsbruck, Köln und schließlich Amsterdam muß er umsteigen, und von jeder Etappe schickt er Alma ein Telegramm. Das Amüsante daran ist, daß sich seine Beschwerden scheinbar verflüchtigen, je näher er dem Ziel, dem Städtchen Leiden kommt. „Befinden eigentlich normal“, kabelt er nach Hause. Was habt ihr denn, mir fehlt doch nichts ...
Mit Freud in Leiden! Hätte das nicht Mahlers Wahlspruch sein können – er, der von klein auf „Märtyrer“ werden wollte? Doch nicht nur die Namen sind bei diesem Treffen kurios. Müssen sich zwei Wiener Größen ausgerechnet an der Nordsee kennenlernen? Dabei läßt sich Freud im Urlaub ungern stören, wie auch Mahler die Ferien heilig hält, weil er nur da zum Komponieren kommt. Doch an diesem 26. August machen beide eine Ausnahme. Freud wegen der Prominenz des Klienten, Mahler, weil ihm sein Elend unerträglich wird. Beide zeigen sich von der Begegnung beeindruckt. „Ich hatte Anlaß, die geniale Verständnisfähigkeit des Mannes zu bewundern“, schreibt Freud viele Jahre später. Mahler seinerseits wirkt nach der Aussprache unendlich erleichtert: „Aus Strohhalm Balken geworden“, verkündet er Alma. Und seinem Leibarzt Joseph Fraenkel vertraut er einige Monate später an: „ich bin jetzt ganz“. Wobei die Tragik darin liegt, daß dieser zur selben Zeit Mahlers Herzinfektion diagnostiziert und die Tragikomik darin, daß er, Fraenkel, sich am Krankenbett rettungslos in Alma verliebt.
Wonach wird Freud gefragt, was wird Mahler erzählt haben? Seine akute Misere dürfte ebenso zur Sprache gekommen sein wie die Prägungen seiner Kindheit. Er entstammt einem Milieu, das der um vier Jahre ältere Arzt gut kennt. Beide sind in mährischen Provinzstädten aufgewachsen und hatten ein jüdisches Elternhaus. Aus bescheidenen Verhältnissen kommend, setzen sie später alles daran, diese frühe Schmach durch aufsehenerregende Erfolge hinter sich zu lassen.
„Er war der Starrsinn, sie die Sanftmut selbst“, beurteilt Mahler seine Eltern. Vater Bernard erarbeitet sich als Schnapsbrenner und Kneipenwirt beharrlich eine Existenz. Seine Frau Marie entstammt einer besser situierten Händlerfamilie. Sie soll unter die Haube, die Ehe wird über ihren Kopf und ihr Herz hinweg geschlossen. Nachdem ihr Erstgeborener früh gestorben ist, heften sich an den 1860 zur Welt gekommenen Gustav doppelte Wünsche, doppelte Ängste. Es folgen noch zwölf Geschwister, von denen sechs schon nach wenigen Monaten sterben. Das Unglück war Stammgast im Hause Mahler.
Der Vater wird als launischer Schwerenöter geschildert, als Choleriker und Chaot. Das klingt nach Alkoholiker und läßt ein Licht auf Mahlers Exzesse der Askese fallen („ich esse nur Grahambrot und Meraner Äpfel“). Der zartbesaiteten, zehn Jahre jüngeren Mutter kommt die Opferrolle zu. Ihr Mann schlägt und betrügt sie, mißbraucht sie wohl auch, um sich dann wieder als rühriger Familienvater zu gefallen. Sie hinkt und leidet an Herzbeschwerden – Symptome, die Gustav später von ihr entlehnt. Die arme Frau übt an den Kindern, was sie selbst entbehrt: Liebe und Beständigkeit. Wie muß sie, die schon ihren Neffen so behandelte, „als ob jeder Tag Geburtstag wäre“, ihren Ältesten vergöttert haben.
Der entpuppt sich als musikalisches Wunderkind. Zwei gegensätzliche Klangwelten prägen sein Gehör: die Militärmusik aus der nahen Kaserne – „mein Entzücken die ganze Kindheit“ – und die Naturkulisse der Wälder. Hinzu kommen Gassenhauer, böhmische Volksmusik und die Gesänge aus der Synagoge. Schon das erste Kunststück des Sechsjährigen, eine Polka mit Trauermarsch, eine mit zwei Kronen dotierte Auftragsarbeit der Mutter, enthält unverkennbar Mahler-Material. Der Soundtrack der Kindheit wird sein Leben lang nachklingen. Komponieren ist für ihn gleichbedeutend mit Erinnern. Er hört sich zurück in die unwiederbringlich verlorene Zeit, öffnet ihre Schatztruhen und Schreckenskammern.
Eine regelrechte Urszene dazu hat wiederum Freud überliefert. Zwischen den Eltern habe sich einmal „eine besonders peinliche Szene abgespielt. Dem Kleinen war es unerträglich geworden und er rannte fort. Doch in demselben Augenblick ertönte aus dem Leierkasten ‘Ach, du lieber Augustin’.“ In ebenso qual- wie lustvollem da capo wird Mahler sich später immerfort in die Musik flüchten. Der verzerrte Volkston in seinen Werken, die martialische Attitüde der Märsche, das zehrende Sehnen, all das speist sich aus den Tiefen der Erinnerung. Ähnlich stark wirken seine Märchenbücher nach, ob im „Klagenden Lied“ oder im dritten Satz der Ersten Symphonie. Auch seine wichtigste Inspirationsquelle hat er schon zu Hause verschlungen: die Volksliedsammlung Des Knaben Wunderhorn, deren Essenz Wilhelm Raabe einmal als „ein neues Lied von Scheiden, Meiden und Sehnsucht“ beschrieb.
Neben den Büchern bildet der Iglauer Wald das bevorzugte Refugium des Jungen. Hierzu hat Alma eine Schlüsselszene mitgeteilt. „Der Vater nimmt den kleinen Gustav mit in den Wald. Ein Versäumnis fällt ihm ein.“ So weist er den Sohn an, auf ihn zu warten und läuft nach Hause. „Dort ist wie immer Ablenkung. Nach Stunden erst wird der Bub vermißt. Der Vater findet das Kind noch immer auf dem Baumstrunk sitzen, die versonnenen Augen ohne Angst und Verwunderung.“ Wie in Trance sitzt er da, lauschend einsgeworden mit der Natur. Er gehört ihr, sie gehört ihm. „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ - er mußte Rückerts Gedichte vertonen.
Von 1875 an studiert er Klavier und Komposition in Wien. Aus materiellen Erwägungen heraus verlegt er sich dann aufs Dirigieren. Fürs erste bleibt ihm nur die Ochsentour durch die Provinz. Bald aber folgen Prag, Leipzig, Budapest und schließlich Hamburg. Sein missionarischer Eifer und seine immense Begabung fallen überall auf. Doch zu penetrant sind seine Machtansprüche, zu absolut seine Forderungen. Jede noch so attraktive Stelle verläßt er vorzeitig, fast immer gibt es Streit. Der Name Gustav, verrät das Lexikon, stammt aus dem Germanischen und bedeutet „Kampfstab“.
Selbst von seinen Freunden wird er als fahrig und geistesabwesend geschildert, ein Mann von aufreizender Ungeschicktheit, von nervösen Ticks beherrscht und obendrein kurzsichtig. „Gustav Malheur“ – die Karikatur eines Künstlers. Wie aber geht das mit seinem Karrierismus, seinem Willen zur Macht zusammen? Ein hilfloser Halbgott? Fast zehn Jahre lang leitet er schließlich die Wiener Hofoper. Allabendlich steht er im Mittelpunkt des Musiklebens – und kapselt sich zugleich ab, als leide er an schwerer Menschenallergie.
In den Ferien komponiert er wie besessen. Bezeichnenderweise kaum Kammermusik. Seine Kunst drängt ins Freie. Sie sei „immer und überall nur Naturlaut!“, schreibt er einmal ungehalten. Schon die Einleitung zur Ersten Symphonie wirkt mit ihrem magischen, von fernen Rufen durchdrungenen Flirren wie eine Beschwörung jener einsamen Stunden im Wald. Doch trotz all der Kuckucksterzen und Lärchentriller, der zwitschernden Flöten und zirpenden Violinen wäre es verfehlt, solche Passagen als Illustrationen zu verstehen. Seine Natur entsteht im Kopf. Er komponiert Tonlandschaften, Gefühlsgemälde, Seelenpanoramen. Mahler ist sich selbst Programm.
Als kreatives Ambiente dagegen bleibt Natur unabdingbar. Er läßt sich sogar eigene Werkstätten im Grünen bauen, die berühmten Komponierhäuschen. Sie stehen noch oder wieder: am Attersee, am Wörthersee sowie in Toblach. Drei herrliche Fleckchen Erde, landschaftlich von geradezu übertriebener Schönheit, und drei magische Orte der Musikgeschichte.
Mit der Gewissenhaftigkeit eines Postbeamten und dem Ingrimm eines Triebtäters schreibt er dort seine ungeheuren Werke. Von 1893 an verbringt er vier Sommer im Gasthof „Zum Höllengebirge“ in Steinbach am Attersee. Vom örtlichen Baumeister läßt er sich einen „Musikpavillion“ am Wasser errichten, halb Schuppen, halb Kapelle. In dieser Zelle, die gerade genug Platz für einen Stutzflügel bietet, komponiert er das Gros der Zweiten und die komplette Dritte Symphonie. Hier an ihrem Geburtsort entfalten sie einen besonderen Zauber. Wer auf den See hinausrudert, das Komponierhäusl vor dem Höllengebirge im Blick und Mahlers Musik im Ohr, der muß ihm beipflichten: wahrhaftig, „der See singt“!
Die Sommerfrische bildet ein Familienritual. Am Attersee leisten ihm seine Geschwister Emma und Otto Gesellschaft und natürlich Justine, die Lieblingsschwester, mit der er quasi in erster Ehe neun Jahre lang zusammenlebt. Ergänzend fügt sich noch Hausfreundin Natalie Bauer-Lechner dem Schwesternharem ein. Willig ordnen sie etwaige eigene Bedürfnisse den seinen unter. Mit seinem Verlangen nach unbedingter Ruhe schikaniert Gustav gar das ganze Dorf. Schnatternde Gänse landen im Kochtopf, spielenden Kindern wird Schweigegeld gezahlt.
Nachdem es ein bewegtes Leben als Waschküche, Schlachthaus und Toilette geführt hat, ist das Häuschen inzwischen wiederhergestellt worden. Anstelle der Blumenwiese macht sich ein Campingplatz breit, aus dem stillen Ufer ist ein belebter Strand geworden. Badeliegen umlagern die Gedenkstätte, Surfer wuchten ihre Bretter an Land. Manch schöngeistiger Besucher erblickt in diesem Treiben eine Entweihung. Doch wer weiß, vielleicht würde der fahrende Geselle Gustav Mahler heute selbst ein Wohnmobil zum Kreativurlaub mieten.
Auch die nächsten Sommer zieht es ihn ans Wasser. 1900 läßt er sich eine Villa am Wörthersee errichten, mitsamt Komponierhäuschen auf einer Kuppe hoch über dem Ufer. „Von allen Wundern und Grauen des Waldes ist er da umfangen“, raunt Natalie. Obwohl es denkbar abgeschieden liegt, läßt er es weiträumig einzäunen; die schmiedeeisernen Tore rosten noch heute im Farngestrüpp. Mit ihren meterdicken Mauern, den Fenstergittern und dem feuerfesten Tresor für die Partituren ist die Klause beredter Ausdruck seiner Phantasien. Nach bewährtem Muster hält Mahler hier Séancen mit der Natur. Im übrigen folgt er unbeirrbar wie ein Metronom seinen Gewohnheiten und entspannt sich ebenso energisch wie er arbeitet. Ob er radelt, rudert oder schwimmt, stets forciert er das Tempo. Seine Lust heißt Anstrengung, er labt sich an Strapazen.
Im März 1902 verlobt er sich mit Alma Schindler, vier Monate nachdem sie sich auf einer Soirée gemeinsamer Bekannter kennengelernt haben. Einer der wenigen Einladungen, denen der Junggeselle Folge leistete, nachdem man ihm versicherte, daß keine fremden Frauen kämen, „nur ein junges Mädchen“ aus der Nachbarschaft. Die aber wird prompt sein Schicksal.
Wenige Tage später besucht er Alma auf der Hohen Warte, so ihre programmatische Adresse. Die Mutter lädt ihn zum Abendessen ein. Mahler will Justine anrufen, ihr Bescheid geben, daß sie nicht auf ihn zu warten braucht. Das ist seit Jahren nicht mehr vorgekommen – prompt vergißt er seine eigene Nummer und muß sie bei der Oper erfragen. Überhaupt legt Wiens vermeintliches Traumpaar Marotten an den Tag, wie sie Woody Allen nicht komischer erfinden könnte. Mahler bittet Alma, statt seiner bei der Mutter um ihre Hand anzuhalten. Es gibt keine Verlobungsringe, keine Hochzeitsfeier, kein Brautgeschenk. Sonst gilt die Heirat am Ende noch! Dafür Flitterwochen in der Eiszeit, zu drei Konzerten im winterlichen St. Petersburg. Mit Migräneanfällen des Bräutigams wohl noch in der Hochzeitsnacht.
„Er möchte, ich hieße Marie“, notiert Alma verwundert im Tagebuch. Später hat sie den Fimmel übernommen. Mahlers Mutter, ja schon die Großmutter hießen Maria oder Marie, auch seine erste Tochter wird so zur Frau ernannt. Routinemäßig hat Freud ihm denn auch einen gehörigen „Marienkomplex“, eine überstarke Mutterbindung attestiert. Statt Liebesbriefen schickt er seiner Alma Mater das Adagietto aus der Fünften, diese Apotheose des Einswerdens, einen symphonischen Kokon. Mit ihrem Jawort beginnt ein Ehedrama, von dem selbst Strindberg noch etwas hätte lernen können. Der melancholische Terrorist und das k.u.k. Superweib – zwei despotisch-sentimentale Naturen, unvereinbar und doch füreinander bestimmt. Nach den relativ friedlichen ersten Jahren, mit ausgelassenen Sommern am Wörthersee, entfremden sie sich mehr und mehr. Auch ihre beiden Töchter vermögen die Kluft nicht zu überbrücken. Statt, wie erwartet, im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens zu stehen, findet Alma sich an einen Eremiten gekettet. Er ignoriert und idealisiert sie zugleich. 1907 stirbt die kleine Maria an einer Scharlachdiphterie. Mit ihr tragen die Eltern ein gut Teil ihrer Hoffnungen zu Grabe. Die Villa wird verkauft; Alma kränkelt und beginnt zu trinken. Mahler stürzt sich in Arbeit, nimmt ein Engagement in New York an. Sie leidet immer ärger an der ausbleibenden Zuwendung, er zeitweise an Impotenz.
Zugleich aber schreibt er seine genialsten Werke. In Toblach, der letzten Sommerfrische, entstehen „das Lied von der Erde“, die Neunte und die unvollendete Zehnte Symphonie. Die Familie logiert oberhalb des Dorfes in einem wuchtigen alten Landsitz, dem Trenkerhof. In sicherem Abstand bezieht Mahler ein aus Fichtenbrettern gezimmertes Hexenhäuschen, wo er vor der monumentalen Kulisse der Dolomiten sein Spätwerk komponiert, Alpenkönig und Menschenfeind in einem. Häuschen und Hof sind heute Ziel Tausender von Pilgern, wobei der umgebende Wildpark ihrem Besuch eine rustikale Note verleiht. Wenn die Tür versehentlich offen steht, inspizieren auch Ziegenböcke das Heiligtum. Von einem Wildschweinpaar geht das Gerücht, sie hießen Gustav und Alma.
Seit sein Herzfehler diagnostiziert wurde, schont Mahler sich ebenso unmäßig wie er sich früher verausgabt hat. Er benutzt einen Schrittzähler und horcht ängstlich auf Atem, Puls und Herztöne. Die bange Beschäftigung mit seinen Körperrhythmen ist im Kopfsatz der Neunten Symphonie künstlerische Form geworden. Die Stimme seines Herzens – Musik durchs Stethoskop. Als erstes existenzialistisches Manifest wird sie zu einem Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts. Spätere Generationen erkennen in Mahlers abgrundtiefer Zerrissenheit, seinem Oszillieren zwischen Apokalypse und Utopie ihr Weltgefühl wieder. Doch auch im Schlimmen war er seiner Zeit voraus. Sein Größenwahn und Fanatismus, das rücksichtslose Monologisieren, die Obsession für Marschrhythmen, die brachiale Rührseligkeit – wenige Jahre später, und man hätte ihn des musikalischen Faschismus zeihen können.
1910 dann der Showdown in Toblach. Auf Kur in der Steiermark verfällt Alma dem heißblütigen Walter Gropius. Entschlossen gewinnt er sie für sich, zugleich aber erfaßt ihn tiefer Respekt für ihren Mann, der dem Alter nach sein Vater sein könnte. In einem Akt mutwilligen Versehens adressiert er einen Liebesbrief an Herrn Direktor Mahler. Die Bombe platzt, der Gatte fällt aus allen Wolken. Alma zeigt sich dagegen erleichtert: „endlich durfte ich alles aussprechen“. Und Gropius setzt nach. Entgegen Almas Anweisung, aber ihre heimlichen Wünsche erfüllend, kommt er nach Toblach. „Sah verborgen den jungen X“, schreibt sie erregt ins Tagebuch und steckt es Mahler sofort. Noch am Abend macht der seinen Rivalen im Dorf ausfindig und führt ihn, mit einer Laterne vorangehend, wortlos zum Trenkerhof. Während Alma sich mit Gropius aussprechen soll, kriecht Mahler in sein Zimmer und liest die Bibel. Eine klare Vereinbarung treffen die drei jedoch nicht. Alma führt ihr Doppelleben in den nächsten Wochen weiter, unterstützt von ihrer Mutter, der Mahler blind vertraut.
Schließlich tritt er die Wallfahrt zu Freud an. Sie sind einander bisher nicht begegnet, doch gibt es private Verbindungen. So ist Mahler der Patenonkel eines der berühmtesten Fälle Freuds: des kleinen Hans. Er hätte auch einen guten Patenonkel für die Psychoanalyse abgegeben, dieser unermüdliche Kindheitsbeschwörer, dieser frei assoziierende Komponist, dieser Tonsetzer des Unbewußten. „Im Traume gelebt und im Wachen geträumt“ stellt er mit neunzehn Jahren fest. Das hätte Freud als Motto für die Gesamtausgabe dienen können.
Auf diskrete Art ist der Fall Mahler sogar in sie eingeflossen. In seiner nächsten größeren Veröffentlichung Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens geht der Seelenarzt den Ursachen psychischer Impotenz nach. Er referiert die „nicht überwundene inzestuöse Fixierung an Mutter und Schwester“. Soweit Sexualität stattfinde, sei sie „launenhaft, leicht zu stören, oft in der Ausführung inkorrekt, wenig genußreich“. Den fundamentalen Zwiespalt solcher Fälle bringt der Meister auf die Formel: „Wo sie lieben, begehren sie nicht, und wo sie begehren, können sie nicht lieben.“
An diesem Paradox ist Mahler gescheitert. Während er in München die Achte probt, eine Lobpreisung des Ewig-Weiblichen, seiner „lieben Frau Alma Maria“ gewidmet, erwartet die im Hotel das Real-Männliche in Gestalt von Gropius zum Schäferstündchen. Und während ihr Mann sich in immer tiefere Hörigkeit hineinsteigert und hemmungslos regrediert – „ich bin ja hauptsächlich Gymnasiast“ –, überschwemmt Alma ihren Liebhaber mit Wollust und wünscht sich auch gleich ein Kind von ihm.
Rasend treibt Mahler die Zehnte Symphonie voran. Schreibt jene Verzweiflungsschreie an den Rand – „Für dich leben! Für dich sterben!“ –, die Alma späteren Besuchern als Ausweis ihrer Machtvollkommenheit vorführen wird. Die Flötenkantilene des Finales wird seine letzte große Melodie, ein todtrauriger Abgesang auf die Liebe seines Lebens. Gäbe es einen Verein der Anonymen Melancholiker, dieses Thema wäre seine Hymne. Doch auch die unterdrückten Aggressionen brechen sich im Schutz der Notenlinien Bahn. Sie ballen sich zu jenem unerhörten neuntönigen Akkord im ersten und im letzten Satz, der den Hörern jedesmal durch Mark und Bein geht. Alles spricht dafür, daß Mahler diese Eruption während der Reise nach Leiden zu Papier gebracht hat, unmittelbar vor oder nach dem Termin mit Freud.
Es bleibt, abgesehen von kleinen Nachträgen, sein letztes Wort als Komponist. In New York zieht er sich eine Infektion der Herzinnenhaut zu. Sie hat weniger mit seinem Herzfehler zu tun als mit dem selbstmörderischen Arbeitspensum, dem Debakel mit Alma und der perfiden Annahme, daß sie ihn nicht verlassen wird, solange er ihrer Pflege bedarf. Seine letzte Lektüre trägt den bezeichnenden Titel Vom Problem des Lebens. Todkrank reist Mahler nach Wien zurück. Dort stirbt er am 18. Mai 1911, gerade fünfzig Jahre alt, an entzündetem Herzen.
(erschienen in der Frankfurter Rundschau)
16. Oktober
Frankfurter Buchmesse
5. November
Nantesbuch, Stiftung Kunst und Natur
8. November
Peking, CUC, Oral History Research Center
29. Januar
München, Biotopia Lab / Botanischer Garten
26. Februar
Berlin, Peter-Ustinov-Schule